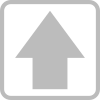|
Nein, Sie brauchen nicht mehr, ich sehe es an Ihren Augen, mir reicht es auch. Kommen Sie, verlassen wir gemeinsam das trostlose Paar, wenden wir uns der Tochter zu, die den Hokuspokus zu legitimieren hat, sie weiß davon nichts, aber sie trägt an der Bürde, vielleicht trägt die Bürde auch sie. Sie ist auf der Welt, weil einmal der Mann sich hat nötigen lassen, sie ist das Mittel und die Garantin für den Erfolg einer fortgesetzten Nötigung, sieht man das einem Kind an? Ein tyrannisches Kind, wie gesagt, kaum dass es auf der Welt ist, es fordert, es zieht auf sich, es lässt nichts bestehen, es erscheint wie die personifizierte Herrschsucht, der die Mutter, ganz dienendes Wesen, lächelnd jedes Opfer bringt. Es sind aber Beziehungen, die sie opfert, die sie, so scheint es, aufgibt, aber sie gibt sie nicht auf, sie unterwirft sie dem einen Willen, den sie nährt und vor dem sie kniet: »Sag, was du willst«, dieser Satz, hundert-, tausendfach in das kleine staunende oder suchende oder schreiende Wesen hineingesprochen, buchstäblich auf den Knien vor ihm, es an den Schultern haltend, das sich heftig abwendende Gesicht immer wieder in die Frontale zurückdrehend, als sei es ein Spiegel, der es nur noch nicht weiß, ein erzwungener Spiegel, ein solcher Satz ist das weibliche Fiat, die Erzeugung des Wesens, das weiß, was es will, damit es einem sagt, was man will, damit man weiß, was man will, damit man unangreifbar wird in diesem Willen. Natürlich weiß die Kleine nicht, was sie will, sie weiß auch nicht, was die Mutter will, weiß nicht, was diese Wortkaskaden bedeuten, deren ›Bedeutung‹ jedenfalls nicht auf diese Weise gelernt wird, sie versteht das Kasperletheater nicht, es ist quälend und lustig, die Pythia zu spielen. Sie sagt auch nicht, was sie will, sie nickt oder stößt ein gepresstes ›Ja‹ hervor, der Mutter reicht es. Schließlich liegt ihr nicht wirklich daran, zu erfahren, was die Tochter will, sie weiß es tief in sich selbst, dort, wo sich der eigene, allzu lange gefangen gehaltene Wille mit einem Mal löst, um sich auf dem langwierigen und selbstquälerischen Umweg über eine eigenmächtig herbeiphantasierte Welt kindlicher Bedürfnisse hier und heute zu realisieren – praktisch unbeirrbar, weil ohne Inhalt. Das Programm, das er an sich erfahren hat, das er kennt, weil es ihn stipulierte, ist einfach, es betreibt die rituelle, als Rückkehr inszenierte Einswerdung der Tochter mit der Mutter, die sie ihrer Mutter verweigern musste, weil ein anderer – männlicher – Wille sie frühzeitig an der Hand führte: ein Fehler, den sie jetzt korrigiert. In der Frauenideologie verfügt sie über eine Waffe, die der Mutter abging, sie zögert nicht, sie einzusetzen: »Sag, was du willst!« Aber der eigene Wille ist keiner, den man gibt, sondern einer, den man lässt. An der Unfähigkeit der Mutter, der Tochter ihren Willen zu lassen, spaltet dieser sich auf: in einen starken, der will, gleichgültig, worum es geht, aber bereit, bis zum Äußersten zu gehen, und einen schwachen, der das, was er will, am Ende preisgeben wird, das Weinen, Schreien und Zerren gehört zum Ritual der unausweichlichen Ergebung unter den Willen der Mutter, die nun, da die Tochter den ihren artikuliert, keine Scheu mehr kennt, den eigenen als den besseren, angemesseneren, überlegenen gegen sie in Szene zu setzen. |
||