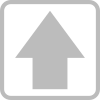|
Eigentlich, findet er, bringt er viel Zeit für die Familie auf, sein Beruf erlaubt ihm, den Kalender weitgehend nach eigenem Gutdünken einzuteilen, er nützt diese Freiheit, obwohl ihn seine Art, sie zu verwenden, immer aufs Neue in Bedrängnis bringt, aber die erübrigte Zeit verwandelt sich auf erschreckende Weise in einen Schlauch, einen Tunnel, erfüllt von modrigen Gerüchen und einer faden Düsternis, durch die er treibt, ein von der Besatzung verlassenes Boot ohne Ruder. Es sei langweilig mit ihm, sagt die Tochter und er spürt das Erschrecken. Noch erinnert er sich an Zeiten, in denen er als eingefleischter Liebling der Kinder galt, den sie nach der Begrüßung hastig ins Kinderzimmer zogen und zerrten. Damals hieß es, es sei sooo langweilig bei den Erwachsenen, sobald er Anstalten machte, sich wieder vom Boden zu erheben: »Bitte bleib!« ›Langweilig‹ also ist es mit ihm, unter der Oberfläche des kindlichen Vernichtungsurteils buchstabiert er eine andere Lesart. Geben Sie’s zu, Sie wissen schon, Sie kennen die andere Lesart, denn es ist bereits jetzt die Ihre, einfach, weil Sie mir zuhören, wenn auch wider Willen: ›Es ist nicht recht‹ heißt sie, es ist nicht recht, unbefangen mit dem Vater umzugehen, sich mit ihm zu vergnügen, weil es der Mutter nicht recht ist, die alle Zugänge kontrolliert, die keinen ungeregelten Verkehr gestattet. Andererseits ist er der Vater, den die Kleine kennt, mit dem sie sich versteht, warum auch immer, den sie anders kennt als die Mutter, von der sie sich steuern lässt, wenngleich unter Protest. ›Langweilig‹, das ist die schonendste Art, sich vom Vater loszumachen, weil man schon zu viel Zeit mit ihm verbracht hat, weil es hohe Zeit ist, zur Mutter zurückzukehren, es ist Ausdruck des mütterlichen Schattens, der jäh oder schleichend über sie fällt. ›Es ist nicht recht‹ heißt: es wäre ihr nicht recht, es wäre ihr sicher nicht recht, in diesem ›sicher‹ liegt die Verschmelzung, die Mutter Tochter-Symbiose, die für das Kind ewige Rückkehr, für die Mutter das ins Künftige ausgelagerte Leben bedeutet, zu dem sie die Tochter erst abrichten muss, das Ende der Durststrecke, das durchgezogene Projekt Tochter, in Wahrheit ein Mutter-Projekt, die Selbst-Werdung der alten in Schmerzen erfahrenen Realität ›Mutter-Sein‹. Wie hochmütig muss eine Frau über ihre eigene Mutter denken, wie unmündig auch, um ein solches Projekt zu ›fahren‹, in dem sie gleichzeitig die Mutter und sich selbst parodiert, sich als diejenige entwirft, die – Punkt für Punkt – die mütterlichen Vorgaben imitiert, um ... sagen wir, es besser zu machen. Dieses Bessermachen bedeutet aber nichts weiter, als es der Mutter gleichzutun und das Spiel um die Tochter zu gewinnen, das die Mutter an sie verlor. ›Es ist nichts weiter dran‹ – am Leben, an was auch sonst -: dieser von der Mutter ererbte biologische Essentialismus dirigiert ein Leben, das nicht bestimmt sein will und sich deshalb über Pflichten bestimmt, die sich aus dem Mutter-Sein ergeben. Banale Pflichten, Alltagspflichten, die aber allesamt darauf hinauslaufen, dass die Frau den von außen auf das Kind wirkenden Impulsen als potentiellen Störfaktoren begegnet, sie abbiegt, zerstört oder in ihre Obhut nimmt. Ist er nicht schön, der Anblick einer unablässig ihr Kind bedenkenden Frau? Ist es nicht eine schöne Sucht? Ist es nicht eine hässliche Sucht? Ist es nicht eine zerstörerische Sucht? Ist es nicht ein auf Zerrüttung angelegtes Programm, das die Welt verschwinden lässt, in welche das Kind hineinwachsen könnte, wenn man es ließe, um an ihre Stelle eine Zelle aus Porzellan zu setzen, an der das Bedürfnis abtropft und fortrinnt und durch ein verborgenes Röhrensystem dubiosen Zwecken zugeführt wird? |
||